| Abkürzung | Lateinischer Name | deutscher Name |
| Her | Hercules | Herkules |
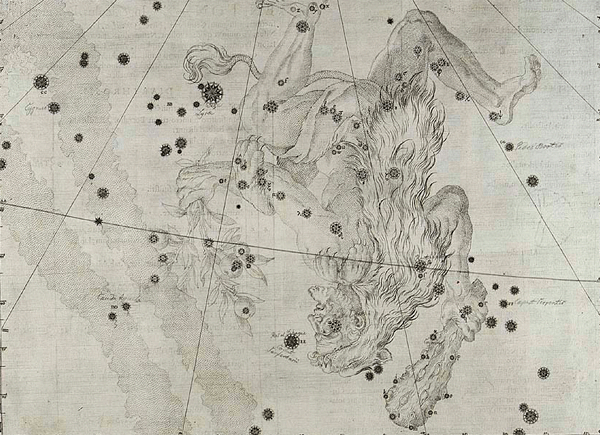
Geschichte
Als Zeus den Säugling Herkules an die Brust seiner Ehefrau, der Göttin Hera, legten wollte, damit dieser die göttliche Milch trinke und die Unsterblichkeit erlange, war Herkules so ungestüm, dass sich ein grosser Strahl Milch über das Himmelsgewölbe ergoss. So soll die Milchstrasse entstanden sein.

Zum Sternbild
Der Hauptstern des Herkules befindet sich hart an der Grenze zum Ophiuchus (Schlangenträger und wird auch Ras Algethi genannt. Diese altarabische Bezeichnung bedeutet "Kopf des Knienden". In vielen bildhaften Darstellungen wird Herkules am Himmel kniend, aber mit dem Kopf nach unten (Süden) wiedergegeben. Die Entfernung ist nur schwer zu bestimmen, dürfte aber bei etwa 430 Lichtjahren liegen. Andere Schätzungen ergaben 700 Lichtjahre. Ist der kleinere Wert richtig, so ist Ras Algethi 830 mal heller als die Sonne. Ras Algethi zählt zu den roten Riesensternen. Sein Durchmesser ist 400 mal grösser als der unserer Sonne. Das sind 560 Mio Km.
Das Sternbild Herkules ist bekannt für einige beachtliche kugelförmige Sternhaufen. Besonders ragt M13 heraus. Er kann bereits mit einem Opernglas leicht als schwacher Nebelfleck aufgefunden werden und liegt genau auf der Verbindungslinie zwischen z und h Herculis, und zwar zwei Drittel der genannten Wegstrecke. Mit einem kleinen Amateur-Teleskop sehen wir schon eine zentrale Verdichtung in dem ansonsten kugeligen Nebelfleck. Da die Sterne in M13 aber nur auf 11. Grössenklasse kommen (es handelt sich dabei um rote Riesen), gelingt eine wenigstens teilweise Auflösung erst mit einem Teleskop über 10cm Öffnung. Die Gesammtzahl der Sterne in M13 ist auch mit grösseren Teleskop kaum abzuschätzen. Zwar wurden bis zur 21. Grössenklasse über 30'000 Sterne gezählt, doch dürfte die wahre Anzahl noch weit darüber liegen. Mit einer Entfernung von etwa 23'000 Lichtjahren zählt M13 zu den nächsten Kugelsternhaufen, günstig zu betrachten vor allem für Beobachter des nördlichen Himmels. Sein tatsächlicher Durchmesser beträgt etwa 100 Lichtjahre, die äussersten Ausläufer erstrecken sich sogar bis auf die doppelte Distanz
Im östlichen Teil des Herkules befindet sich der Apex der Sonnenbewegung, also der Zielpunkt, auf den sich die Sonne mitsamt den Planeten zubewegt. Systematische Beobachtungen der Sternbewegungen zeigen, dass sich die Sterne von diesem Punkt entfernen und am Gegenpunkt (antapex) wieder zusammenzuströmen scheinen. Beobachten wir dagegen rechtwinklig zur Verbindungslinie Apex-Antapex, so scheinen die Sterne systematisch "nach hinten" zu fliegen. Dieser Effekt zeigt sich nur bei der Untersuchung einer grossen Zahl von Sterne, konnte aber bereits 1783 von Wilhelm Herschel an einer kleineren Zahl von Sternen entdeckt werden. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Sonne relativ zu ihren Nachbarsternen in Richtung Apex bewegt, beträgt knapp 20km/s